 
Fax: +493046795841 www.thongtinberlin.de - www.thongtinberlin.net - www.dvtnradio.com - www.dvtnradio.de
|
Vietnamesen in Deutschland Aus einem unsichtbaren Land
Etwa hunderttausend Vietnamesen leben bei uns, mit vietnamesischem Pass oder deutschem oder ohne legale Papiere. Aber als im Spätsommer heftig gestritten wurde, wer in diesem Land dazugehören darf oder nicht, kamen diese hunderttausend nicht vor. Ein Besuch.
14. November 2010
 Es
ist nicht weit nach Vietnam, man nimmt die
Straßenbahn. Steigt in die Linie 8 und fährt
eine Viertelstunde lang aus der Mitte
Berlins heraus nach Lichtenberg, das
wirklich licht ist: So viel Himmel sieht man
in Berlin selten, und so viele Plattenbauten
auch nicht. Dann steigt man wieder aus,
Herzbergstraße/Industriegebiet heißt die
Station, läuft durch ein Tor auf einen Hof,
hinter dem sich eine weite
Industrielandschaft öffnet, früher mal VEB
Elektrokohle. Steht vor vier langen weißen
Hallen, schiebt den Vorhang zur ersten
beiseite und geht einfach hinein nach
Vietnam.
Es
ist nicht weit nach Vietnam, man nimmt die
Straßenbahn. Steigt in die Linie 8 und fährt
eine Viertelstunde lang aus der Mitte
Berlins heraus nach Lichtenberg, das
wirklich licht ist: So viel Himmel sieht man
in Berlin selten, und so viele Plattenbauten
auch nicht. Dann steigt man wieder aus,
Herzbergstraße/Industriegebiet heißt die
Station, läuft durch ein Tor auf einen Hof,
hinter dem sich eine weite
Industrielandschaft öffnet, früher mal VEB
Elektrokohle. Steht vor vier langen weißen
Hallen, schiebt den Vorhang zur ersten
beiseite und geht einfach hinein nach
Vietnam.
Es heißt nur anders: Dong Xuan Center, 26.000 Quadratmeter für Nagelpflege, Zitronengras, Plastiksonnenblumen, Jasmintee, Magazine, Ingwer, Stricknadeln, Haarschnitte, Reisnudeln, Rollwägelchen, DVD-Spieler, Koffer, Fische, Kabel, Strumpfhosen. Wer noch nie in Hanoi oder Saigon war, stellt sich vor, dass die Markthallen dort genauso aussehen, wer schon mal da war, sagt, dass es genauso ist. Und wer Kunstfaserpullover mit aufgestickten Katzenköpfen kaufen möchte, wird sie hier finden, und auch die Rentnerinnen, die sie so gern tragen: Denn im Dong Xuan Center von Lichtenberg kaufen nicht nur die vietnamesischen Berliner ein, sondern auch die berliner Berliner.
|
frische Fische, falsche Blumen, Zitronengras: In den Hallen des Dong Xuan Center in Lichtenberg © Julia Zimmermann |
Sie laufen einem schon auf dem Hof entgegen mit ihren Tüten, und sie kommen zur Mittagspause her. Es gibt im Dong Xuan Center das beste vietnamesische Essen der Stadt. Sagen Vietnamesen. Im Restaurant Nha Hang Viet-Nam zum Beispiel, das wie eine Bahnhofsgaststätte aussieht, wenn es noch Bahnhofsgaststätten gäbe und man dort Karaoke singen könnte.
Wo ist der Feridun Zaimoglu der deutschen Vietnamesen?
Hier, im Dong Xuan Center, wird sichtbar, was in der Integrationsdebatte wie unsichtbar wirkt: dass in der Bundesrepublik sehr viele Vietnamesen leben und arbeiten. Etwa hunderttausend sind es, mit vietnamesischem Pass oder deutschem oder ohne legale Papiere. Aber als im Spätsommer heftig gestritten wurde, wer in diesem Land dazugehören darf oder nicht, kamen diese hunderttausend nicht vor. Höchstens als Klischee, fleißig und leise, die Kinder gut in der Schule - Thilo Sarrazin hat das auch so geschrieben.
Wie ist diese Unsichtbarkeit entstanden? Sie irritiert, weil es doch in deutschen Städten so viele vietnamesische Gemüsegeschäfte gibt und ständig neue vietnamesische Restaurants aufmachen. Man fragt sich auch ratlos, wo die Schriftsteller dazu sind, die ihre Geschichten aufschrieben: die Geschichten der Boat People, die in den siebziger Jahren aus dem Süden Vietnams in die alte Bundesrepublik flüchteten, oder der Vertragsarbeiter aus dem Norden, die in den Achtzigern in die DDR kamen und blieben. Wo ist der Feridun Zaimoglu dieser deutschen Vietnamesen? Das Gesicht für die Talkshows, die Stimme, die erklärt, wie das ist, in diesem Land zu leben, dageblieben zu sein nach Rostock-Lichtenhagen, wo 1992 ein Asylbewerberheim voller Vietnamesen tagelang von Rechtsradikalen angegriffen wurde und die Nachbarn applaudierten.
In sechzehn Jahren ist nicht viel passiert
Ein Gesicht und eine Stimme gibt es: Minh-Khai Phan-Thi. Sie ist die Erste, die auf Anhieb jedem einfällt und die, seit sie 1992 bei den Lichterketten-Demonstrationen aufgetreten ist, ihre Geschichte oft erzählt hat: Die Eltern kamen in den frühen Siebzigern nach Darmstadt, wo ihre Tochter geboren wurde, die Mutter wurde promoviert, der Vater Ingenieur, Minh-Khai Phan-Thi aber ging zum Fernsehen, wurde Schauspielerin und so etwas wie eine Expertin für Integrationsfragen.
„Es ist nicht besser geworden“, sagt sie über den Stand der Debatte, wir treffen uns in Berlin-Mitte, wo sie heute wohnt. „Ich habe das Gefühl, dass ich vor sechzehn Jahren genau das Gleiche gesagt habe wie heute.“ Sie klagt über die mangelnde Großzügigkeit der Deutschen, ihre Trägheit zu erkennen, dass ihr Land ein Einwanderungsland sei, darüber, wie demütigend die Einbürgerungsprozedur sei, und sie bringt all das in einem Satz unter: „Wenn Philipp Rösler Philipp Ngyuen hieße, wäre er nicht Bundesgesundheitsminister.“
Eine Stärke - und eine Schwäche
Wenn man sie dann nach den Vietnamesen in Deutschland fragt, sagt sie das Gleiche wie die Journalistin Pham Thi Hoai, wie der Kulturwissenschaftler Kien Nghi Ha oder die Modedesignerin Tutia Schaad: Sie sind unauffällig. Sie arbeiten hart. Sie schicken Geld nach Hause und ihre Kinder aufs Gymnasium. Und sie interessieren sich leider wenig für die Gesellschaft, in der sie leben.
„Vietnamesen sind sehr anpassungsfähig“, sagt Pham Thi Hoai. „Das ist ihre Stärke, aber auch ihre Schwäche. Sie geben sich sehr leicht auf. Wenn sie aber nicht gerade illegal hier leben, sind es die besten Deutschen.“ Pham Thi Hoai, geboren 1960, gehörte zu den hoffnungsvollsten Stimmen der jungen vietnamesischen Literatur, ihr erster Roman wurde 1988 auch auf Deutsch übersetzt, das sie spricht, seit sie 1977 zum Studium nach Ost-Berlin kam. Heute ist sie eine persona non grata in Vietnam: wegen ihrer regimekritischen Website talawas.org, die sie seit 2001 von Berlin aus betrieb, wo sie mit deutschem Mann und deutschem Pass lebt. Ihr Sohn, sagt sie, achtzehn Jahre alt, ist Deutscher, versteht sich auch so und die Sarrazin-Debatte übrigens überhaupt nicht.
Rückkehrpläne in ein Land, das zugrunde gerichtet wird
Pham Thi Hoai wirkt im Gespräch gleichzeitig auf eine wache Art entspannt und hochkonzentriert. „Die Vietnamesen leben gern und gut hier“, sagt sie leise, „aber sie empfinden Deutschland, das für viele zur Wahlheimat geworden ist, trotzdem als Gastland, das sie nichts angeht.“ Meint sie das auch selbstkritisch? Schon, antwortet sie, „ich verfolge die deutschen Probleme sehr interessiert. Aber wenn ich mich engagiere, dann mit viel mehr Leidenschaft für die Probleme zu Hause.“
Desillusioniert erzählt sie über dieses heutige Vietnam, das von inkompetenten Führern zugrunde gerichtet werde, ökonomisch, ökologisch, kulturell. Aber Pham Thi Hoai nennt es auch das „Inland“, in das sie, wenn sie alt sei, zurückkehren möchte: wie die meisten vietnamesischen Rentner. Wie wäre es, wenn sie vorher noch den Roman der Vietnamesen in Deutschland schriebe? „In den letzten neun Jahren habe ich nur journalistisch gearbeitet“, antwortet sie. „Wenn ich jetzt in die Literatur zurückkehren würde, müsste ich meine Stimme erst wiederfinden.“
Erfolg ist möglich
Pham Thi Hoai wirkt beim „Dong Xuan Festival“ mit, das das Berliner Hebbel Theater am Ufer vom 21. November an feiert: mit Touren ins Center nach Lichtenberg, mit Diskussionen, Filmen, Performances. Das Festival und auch die Dresdener Fotoausstellung über die Vertragsarbeiter in der DDR, die 2009 zu sehen war, könnten erste Zeichen einer wachsenden Aufmerksamkeit für die gemeinsame Geschichte sein, die im Grunde viergeteilt ist: zwischen Ost und West in Deutschland und Süd und Nord in Vietnam.
„Die Mauer zwischen den Nord- und Südvietnamesen ist noch viel länger da als die Berliner Mauer“, sagt Pham Thi Hoai. Diese Differenz zwischen den Siegern des Kriegs gegen die Amerikaner und den Unterlegenen mache es schwierig, eine Community zu bilden: talawas.org sollte ein Forum dafür sein, Pham Thi Hoai hat die Website aber kürzlich eingestellt. Jetzt, sagt sie, müsse die jüngere Generation übernehmen.
Zu dieser Generation gehört Tutia Schaad. Die Modedesignerin, 28 Jahre alt, geboren in Hanoi, aufgewachsen in Lausanne, wird mit ihrem Label Perret Schaad gerade sehr bekannt, beim Theaterfestival ist sie auch dabei. Tutia Schaad hat einen Schweizer Pass, nennt sich aber mit schönster französischer Melodie ein „Mittekind“. Sie wollte immer unbedingt nach Deutschland. Manchmal, erzählt sie etwas verlegen, fühle sie sich egoistisch, weil sie nicht verstehe, warum die Leute sich beschwerten. Sie habe nie Probleme gehabt. Freunde sprächen davon, nach Amerika auszuwandern, weil es dort leichter sei (viele junge Akademiker gehen auch nach Vietnam zurück). „Aber ich hatte nie das Gefühl, Erfolg sei unmöglich für mich.“
Plötzlich eng und alt und phantasielos
Tutia Schaad kennt die Situation der traditionell lebenden Familien natürlich auch. Ihr Beispiel, sagt sie, könnte aber zeigen, wie sehr es sich lohnt, aus dem Muster auszubrechen: „Es kann auch ein Vorteil sein, aus einer anderen Kultur zu kommen“, sagt sie. Pham Thi Hoai redet genauso: „Man hat ganz andere Chancen als ein normaler Deutscher. Der kann zum Beispiel nicht allein mit seiner deutschen Sprache einen Job bekommen.“ Als Übersetzerin wie sie, zum Beispiel.
Das ist nicht naiv, das könnte der Perspektivwechsel sein, der aus der Integrationsdebatte eine über Modernisierung macht. „In einer Diasporakultur, wie sie die Vietnamesen in Deutschland leben, sind die Identitäten wandelbar“, erklärt der Kulturwissenschaftler Kien Nghi Ha. „Sie diffundieren durch Grenzen. Das ist viel zukunftsgewandter als die Vorstellung einer abgeschotteten deutschen Leitkultur.“
Kien Nghi Ha kam 1979 als Siebenjähriger mit seinen Eltern nach Deutschland, und wenn man ihm zuhört - wir sitzen im „Anita Wronski“ am Kollwitzplatz, wo er mit seiner Familie wohnt -, wie er vietnamesische Restaurants als Räume beschreibt, in denen die Rollen zwischen Gastgeber und Gast sich fast spielerisch umkehren, und was das für das Selbstverständnis dieses Landes bewirken könnte: da wirkt die Debatte, wie sie bislang um Integration geführt wurde,
Wirklich sensationell
Australier, Kanadier und Amerikaner, sagt Kien Nghi Ha, gingen viel offener damit um, wenn innerhalb einer Demokratie unterschiedliche Gruppen lebten. Die Angst vor Parallelgesellschaften, das sei Misstrauen und der deutsche Zwang zur Kontrolle. Die Wissenschaft sei schon so viel weiter, nur leider - und da klingt Kien Nghi Ha, der wie ein Wissenschaftler durch und durch redet, irgendwie verzweifelt bei guter Laune -, leider kämen diese Erkenntnisse nicht in der politischen Diskussion an.
Natürlich weiß Kien Nghi Ha um die Zwangsselbständigkeit, um den Bildungsdruck auf Kinder, die sich so eine Anerkennung verschaffen, die ihnen erst mal verwehrt bleibe. Aber er schaut auch auf Speisekarten, mit denen zwischen Vietnam und Amerika experimentiert wird, bis am Ende beim Vietnamesen um die Ecke eine Nudelsuppe auf den Tisch kommt, die auch Deutschen schmeckt, und sagt: „Da zeigt sich, was für ein Wissen aus allen Ecken der Welt über Migrationsrouten nach Deutschland kommt, um damit neue Ökonomien zu begründen.“
Damit das sichtbar wird, muss man wieder nach Lichtenberg. Da steht ein Berliner in Halle 1 mit einer Dose Jasmintee in einem Geschenkeladen und zeigt sie dem vietnamesischen Besitzer. „Den habe ich noch nie probiert“, sagt er. „Aber der Rindermagen neulich war sehr gut, da musst du mir beim nächsten Mal was mitbestellen.“ Vielleicht eine Zufallsszene. Vielleicht ein Anfang. Vielleicht längst Normalität. Die Suppe schmeckt hier übrigens wirklich sensationell.
Text: F.A.S.
Bildmaterial: Cinetext/Mona Filz, Julia
Zimmermann, picture alliance / dpa



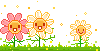 Email:
Email:
